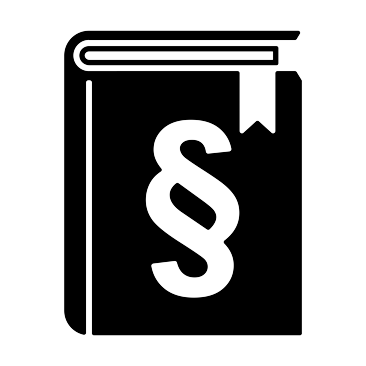Kommt in die Berner Bundespolitik endlich ein wenig Bewegung bezüglich unserer Brandthemen «Alternierende Obhut» und «Eltern-Kind-Entfremdung»?
Es hört es sich vielversprechend an, dass der Bundesrat einen Bericht zu den Modernisierungs-Bestrebungen bei Familienverfahren veröffentlicht und darin sogar erkennt, dass die momentane Umsetzung von familienrechtlichen Streitigkeiten nicht vollständig funktioniert, die KESB-Zuständigkeiten verändert werden müssten und ein Angleich der Verfahrensregelungen an die momentanen gesellschaftlichen Verhältnisse stattfinden müsse.
Danach wird es in diesem Bericht leider weniger konkret, und bei den weiteren nächsten Schritten, die der Bundesrat unternehmen will, muss man leider erkennen, dass sich das Ganze wohl noch jahrelang hinziehen wird. Als Schlussfolgerung wird in der Bundesrats-Medienmitteilung in Aussicht gestellt, dass bis Ende 2026 eine Vernehmlassungsvorlage mit konkreten Reformvorschlägen und Gesetzesänderungen zusammen mit den Kantonen und Fachvertretern (genannt werden Gerichte, KESB, Kinder- und Jugendämter und Anwaltschaften) erarbeitet und verabschiedet wird.
Welche Zielsetzung haben die Reformvorschläge des Bundesrates?
Nach den verschiedenen parlamentarischen Motionen und Postulaten der vergangenen Jahre 2019 bis 2023 hatte sich der Bundesrat mit den Verfahrensrealitäten in familienrechtlichen Streitigkeiten beschäftigt. Nach Umfrage bei den Kantonen und der Vergabe von Rechtsgutachten (z.B. an Rechts-Professoren der Universitäten Basel und Neuchatel) wurde erkannt, dass es einer Modernisierung bei der Verfahrensregelung bedarf. Gestützt wird der Reformbedarf darauf, dass sich über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte die Formen des familiären Zusammenlebens stark verändert haben und viele Kinder heute mit Eltern aufwachsen, die nicht bzw. nicht mehr verheiratet sind.
Die Familiengerichtsbarkeit wird bekanntlich in der Zivilprozessordnung (ZPO) und im Zivilgesetzbuch (ZGB) geregelt und unter kantonaler Hoheit von den Zivilgerichten und den Kinder- und Erwachsenen-Schutz-Behörden (KESB) umgesetzt.
Der Bundesratsbericht nennt die folgenden Erkenntnisse, die gesetzgeberischen Handlungsbedarf für Anpassungen in ZGB und ZPO ergeben:
-
Die Zuständigkeit der KESB bei unverheirateten Paaren sei zu hinterfragen und tendenziell ordentlichen Gerichten zu übergeben.
-
Die wesentlichen Elemente der Familiengerichtsbarkeit sollen künftig schweizweit einheitlich (ohne kantonale Unterschiede) umgesetzt werden.
-
Die ZPO sollte in Zukunft neue Bestimmungen für ein «Familienverfahren» enthalten, namentlich zum Familienschutzverfahren (nach dem Vorbild des aktuellen Eheschutzverfahrens) sowie neue Bestimmungen zu Scheidung und zu den selbständigen Klagen betreffend den Kinderbelangen (z.B. Abstammungs- und Unterhaltsklagen).
-
Das geltende Verfahrensrecht soll im Sinne einer Förderung und Stärkung der einvernehmlichen Konfliktlösung verbessert werden. Dazu soll das bestehende Instrument des Einigungsversuchs konsequent gestärkt werden. Für den Fall, dass keine Einigung erzielt werden kann, soll das Gesetz in Zukunft ausdrücklich den Einbezug von Konfliktdeeskalations- bzw. Konfliktlösungsmethoden (z.B. obligatorische und angeordnete Mediation) im Verfahren vorsehen.
Gerade zum letzten der aufgeführten Punkte hatten wir bereits in den IGM Nachrichten vom Oktober 2023 den Pilotversuch des ZFIT (Zentrum für Familien in Trennung) in Bern vorgestellt. Damals hatte uns ein Artikel der Berner Zeitung mit der Überschrift «Zerstrittene Paare müssen neu zum Gespräch antraben» aufhorchen lassen, der die ZFIT-Eröffnung und die ZFIT-Vorgehensweise vorstellte. Interessant, dass fast zwei Jahre später und nach dem Bundesratsbericht vom 6. Juni 2025 genau dieselbe Schlagzeile am 10. Juni 2025 vom Berner Landboten und vom Thuner Tagblatt unverändert nochmals unverändert verwendet wurde: «Zerstrittene Paare müssen neu zum Gespräch antraben». Neu wird die mit Erfolg beendete ZFIT-Pilotphase in Bern dokumentiert und eine Erweiterung von ZFIT in der gesamten Schweiz als mögliche Bundesrats-Massnahme in den Raum gestellt.
Worum geht es beim ZFIT?
Jedes Jahr sind in der Schweiz rund 30’000 Kinder direkt oder im familiären Umkreis von einem Trennungs- oder Scheidungsverfahren betroffen. Dies stellt für Kinder und Jugendliche ein kritisches Lebensereignis dar. Je strittiger das Verfahren ist, desto grösser ist die Belastung für die betroffenen Kinder und Jugendlichen.
Weil es streitenden Eltern vielfach nicht gelingt, das Wohl ihrer Kinder im Auge zu behalten, werden behördlich angeordnete Entscheide über die Kinderbelange notwendig. Dies lässt aber zumeist einen Elternteil unzufrieden zurück, wodurch der Konflikt weiterschwelt und sich zunehmend verschlimmert. Darunter leiden wiederum auch die Kinder.
Vor diesem Hintergrund konstituierte sich bereits im Jahr 2019 in der Stadt Bern eine Gruppe aus unterschiedlichen Organisationen und Disziplinen mit dem Ziel, in Gerichts- und KESB-Verfahren eine frühzeitige Deeskalation der Elternkonflikte zu erreichen. Gemeinsam mit der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) sowie der Anlaufstelle KESCHA entwickelte man so das Zentrum für Familien in Trennung, ZFIT. Als Mitinitiantin dieses Trägervereins engagiert sich seit Jahren die Oberrichterin beim Obergericht des Kantons Bern, Anastasia Falkner. Frau Falkner kam auch bereits bei einigen der seitens IGM oder GeCoBi organisierten Podiumsdiskussionen zu Wort und setzt sich allgemein für deeskalierende Massnahmen (wie auch die alternierende Obhut) und gegen Eltern-Kind-Entfremdung ein.
Gerichtsanordnung zur ZFIT-Beratung: Wie ist der Ablauf?
Besteht zwischen den Elternteilen in familienrechtlichen Verfahren ein Konflikt zu kindesrechtlichen Fragen, kann das Gericht oder die KESB in Bern eine Beratung im Zentrum für Familien in Trennung ZFIT anordnen. Über den Beratungszeitraum von vier Monaten finden alle zwei Wochen Beratungsgespräche im ZFIT statt. Die Beratung wird gemeinsam mit beiden Eltern durchgeführt. Die Beratungsgespräche dauern zwischen 60 und 90 Minuten. Die Interessen und Bedürfnisse der Kinder stehen im Zentrum der Beratung. Die Teilnahme an den Gesprächen, zu denen die Eltern ins ZFIT eingeladen werden, ist aufgrund der behördlichen resp. gerichtlichen Anordnung für beide Elternteile obligatorisch. Eine allfällige Rechtsvertretung nimmt an den Gesprächen im ZFIT nicht teil; die Klientinnen und Klienten können jedoch immer wieder Rücksprache mit ihrer Rechtsvertretung nehmen. Das obligatorische Angebot kostet 2’500 Franken pro Familie, welche die Eltern bezahlen müssen. Es läuft mit diesen Kosten genau gleich wie bei Verfahrenskosten einer Scheidung.
Nun wurden die ZFIT-Verfahren durch die Universität Freiburg mit einer positiven Bilanz ausgewertet: In mehr als 2/3 der Fälle konnten Einigungen oder zumindest Teileinigungen der Eltern zur Kinderbetreuung und Handhabung des Besuchsrechts erzielt werden. Durch die erfolgreiche ZFIT-Mediation reduzierte sich auch die Anzahl der angeordneten KESB Beistandschaften um die Hälfte. Erfreulich auch, dass die Gerichte entlastet und die Eltern durch die frühe Intervention befähigt werden, selber Entscheide zum Wohle ihrer Kinder zu treffen. Bei ZFIT gibt man sich aber auch realistisch, denn die Auswertung der Pilotphase liefert allein Erkenntnisse, bei welchen Themen der Gesetzgeber im Verfahrensrecht nachbessern müsste. «Man kann das Kontaktrecht eines Elternteils gerichtlich verordnen aber faktisch nicht durchsetzen», sagt die Oberrichterin und ZFIT-Mitgründerin Anastasia Falkner. (Das kann man allerdings auch anders sehen, meint die IGM Schweiz dazu ...!)
Wie geht es weiter?
Nach der erfolgreichen Pilotphase in Bern könnten nun standardisierte Verfahren zur Konfliktdeeskalation und spezialisierte Beratungsstellen schweizweit eingeführt werden. Die Auswertungen von ZFIT in Bern liefern eine der Grundlagen für Anpassungen im Zivilprozessrecht des Bundes. In seiner jüngsten Medienmitteilung hat der Bundesrat genau das in Aussicht gestellt.
Fazit:
Kurzfristig werden sich leider am gegenwärtigen Leid und Dilemma der vielen von Kontaktabbruch und Entfremdung betroffenen IGM-Mitglieder wohl wenig gravierende Veränderungen ergeben. Mittelfristig erkennen wir aber Chancen für Verbesserungen. Seitens IGM Schweiz bleiben wir zusammen mit unseren verschiedenen Kooperationspartnern in Bern eng am Thema dran, um «den Ball in die richtige Richtung» voranzutreiben.
IGM Kommentar
«Zu ZFIT möchten wir auch nach dieser als erfolgreich deklarierten Pilotphase unsere schon 2023 geäusserte Meinung erneuern», sagt IGM-Präsident Thomas Jakaitis. «Es ist der richtige Weg, zerstrittene Eltern über angeordnete Beratungen an das Wohl ihrer eigenen Kinder zu erinnern und bestenfalls Einigung in Kinderbelangen zu erreichen. Es bleibt allerdings abzuwarten, welche Sanktionsmechanismen der Bundesrat und die Gerichte vorschlagen, wenn sich ein Elternteil der Teilnahme an den obligatorischen Beratungen ganz oder teilweise verweigert. Hier hat sich der Bundesrat noch nicht konkret geäussert, und das wird wohl die Knacknuss der kommenden Beratungen und gesetzgeberischen Ausarbeitungen.» Ohne klare Sanktionsmassnahmen werden leider die von den «Umgangsverweigerern» praktizierten Kontaktabbruch-, Verzögerungs-, Verweigerungs- und Entfremdungstaktiken bekräftigt. Die Folge: Engagierte Berater und Therapeuten geben resigniert auf und ziehen sich zurück.